4 Deutschland – Staatenwettbewerb
4.1 Überblick zur Entwicklung des Honorars
4.1.1 Sicht der Urheber
Die Geschichte des Urheberrechts wird in der Regel aus Sicht der Urheber geschildert. Die treibenden Kräfte waren aber einerseits die Verleger, andererseits die Regierenden in ihrem Bestreben, die Produktion und Verbreitung der Schriften zu zensieren und zu kontrollieren. Die Autoren wandten sich eher gegen die Zensur und die ungleiche Verteilung der Erlöse, — verständlicherweise: Christian Fürchtegott Gellert, dessen Fabeln und Erzählungen vor der als Sturm und Drang bezeichneten Periode zu den meistgelesenen Werken in Deutschland zählten, wurde 1746–1748 von seinem Verleger mit einem Honorar von 31 Gulden entlohnt. Sein Verleger Wendler wurde durch die Fabeln wohlhabend, während Gellert bis zu seinem Tod in bescheidenen Verhältnissen lebte. Um den Todeszeitpunkt Gellerts wurde das „Verlagsrecht“ an Gellerts Schriften unter Beteiligung der Weidemannschen Buchhandlung für 10.000 Taler verkauft.1)
Wenn man die Frage klären will, ob das Urheberrecht vorteilhaft oder nachteilig gewirkt hat oder eher irrelevant war, genügt die auf den Autor zentrierte Darstellung des Rechts und die heute gängige Vorstellung (kein Honorar, keine Namensnennung, abhängig von Patronage etc.) über dessen Wirkung ohne tatsächliche Faktengrundlage nicht. Um die Ausgangslage zu erfassen, ist es notwendig, rechtliche und wirtschaftliche Umstände des Buchhandels, die Produktion, Kapazitäten, Vertriebsmöglichkeiten, Preise oder die Distribution der Bücher in ihrer Gesamtheit zu betrachten, statt nur den zu klein gewählten Ausschnitt der Rechte der Autoren. In rechtlicher Hinsicht tritt das monopolistische Element des Verbots in den Vordergrund.
4.1.2 Sicht der Verleger
<html><figure class=„rahmen mediaright“> <a title=„Anton Graff [Public domain], via Wikimedia Commons“ href=„https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3APhilipp_Erasmus_Reich_1774.jpg“><img width=„256“ alt=„Philipp Erasmus Reich 1774“ src=„https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/55/Philipp_Erasmus_Reich_1774.jpg/512px-Philipp_Erasmus_Reich_1774.jpg“/></a> <figcaption caption=„caption-text“>Verlagsleiter Philipp Erasmus Reich</figcaption></figure></html>
Gellerts Schriften waren auch ein Bestandteil einer anderen Begebenheit:2) Am 10. Mai 1765 versammelte sich in Leipzig nahezu ein Sechstel der deutschen Verleger, um auf Einladung Philipp Erasmus Reichs, damals Fürst der Buchhändler und Leiter des Verlags Weidemann Buchhandlungsgesellschaft über Maßnahmen gegen den Nachdruck zu beraten.3) Diese Versammlung erhielt aus Wien ein »Avertissement« des in den Adelsstand erhobenen Druckers Johann Thomas Trattner, in dem dieser mitteilte, er habe zahlreiche Schriften, einschließlich derer von Gellert, nachgedruckt und würde diese in guter Qualität für 13 Gulden 30 Kreuzer anbieten. Dies war vergleichsweise günstig, da die Originale 37 Gulden kosteten, worauf Trattner selbstverständlich hinwies. Während also der eine Verleger das Verlagsrecht für 10.000 Taler kaufte, druckte der andere Gellerts Schriften ohne ein entsprechendes Recht nach. Trattner wurde für sein Tun auch noch in den Adelsstand erhoben, sein Geschäftsbetrieb von Erzherzögen besichtigt, und der spätere Kaiser Joseph II. wurde bei ihm mit dem Druckhandwerk vertraut gemacht.4) Wieso sollte der berühmteste Nachdrucker im Heiligen Römischen Reich, Edler von Trattner, für seine Leistungen auch nicht belohnt werden?5) Schon Queen Elisabeth hatte den Geschäftsbetrieb des noblen Piraten Sir Francis Drake, die Golden Hinde, besucht und ihn anlässlich der Besichtigung zum Ritter geschlagen.6) Dies waren zwar Ausnahmen, aber sie zeichnen das Bild der Ausgangslage.
<html><aside class=„betont-ausschnitt“>Der Verleger erwirbt für sein Produkt Buch vom Autor den ersten Grundstoff, so wie der Tuchfabrikant sich die Wolle für seine Tücher anschafft.</aside></html>
Der Kenner des Buchmarkts dieser Zeit, Goldfriedrich, bringt seine Zweifel an den Beschwerden über den Nachdruck augenzwinkernd zum Ausdruck, wenn er über die 1766 von Reich organisierte Versammlung der Verleger im Hause des Fürsten der Buchhändler berichtet, nämlich dass nicht alle Mitglieder der Sozietät gegen Nachdruck anwesend waren: »Herr David Iversen aus Altona z. B. war früh um halb elf noch nicht aufgestanden, des Nachmittags um vier Uhr aber,hielt er seine gewöhnliche Mittags-Ruhe`; auch August Lebrecht Stettin aus Ulm war ,wegen seines Schlafens nicht anzutreffen`«.7) So stand es um den angeblich wirtschaftlich verheerenden Nachdruck: Die gewöhnliche Mittagsruhe wurde deswegen nicht unterbrochen. Den vom Nachdruck gebeutelten Verlegern ging es, auch wenn sie ständig über drohenden Ruin und Verfall des Buchhandels klagten, offenbar nicht so schlecht.
4.1.3 Autoren sind Lieferanten
Wenn man den Nachdruck in Deutschland in der Zeit vor dem Siebenjährigen Krieg beschreiben will, führt die Konzentration auf den Autor zu Missverständnissen. Wie die Verleger die Autoren in der Zeit des Siebenjährigen Krieges einordneten, wird deutlich, wenn man Pütters Beitrag von 1774 liest, der den damaligen Stand der Dinge zusammenfasste: Der Verleger erwirbt für sein Produkt Buch nicht nur Papier, sondern vom Autor den ersten Grundstoff, so wie der Tuchfabrikant sich die Wolle und übrigen Zutaten für seine Tücher anschafft.8)
<html><figure class=„rahmen medialeft“><a title=„Johann Elias Haid [Public domain], via Wikimedia Commons“ href=„https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AJohannStephanP%C3%BCtterHaid1777.jpg“><img width=„256“ alt=„JohannStephanPütterHaid1777“ src=„https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/63/JohannStephanP%C3%BCtterHaid1777.jpg/256px-JohannStephanP%C3%BCtterHaid1777.jpg“/></a><figcaption class=„caption-text“>Johann Stephan Pütter</figcaption></figure> </html>
Die Konzentration auf den Autor hat den Nachteil, dass die Geschichte bis zu diesem Wendepunkt schnell erzählt ist, etwa mit dem unternehmerischen Versuch des deutschen Nationaldichters der Weimarer Klassik Johann Wolfgang Goethe, dessen Schaffensperiode sich ziemlich genau mit der für das Entstehen des deutschen Urheberrechts entscheidenden Periode deckt. Sein Lustspiel Die Mitschuldigen bot er 1769 den Verlegern Fleischer in Frankfurt am Main und Reich in Leipzig an; beide lehnten ab. 1773 schrieb Goethe »ohne weder rückwärts, noch rechts, noch links zu sehn« am Götz von Berlichingen und hatte nach »etwa sechs Wochen […] das Vergnügen, das Manuskript geheftet zu erblicken«.9) Es war eine Umarbeitung, nachdem Herder die erste Fassung von 1771 heftig kritisiert hatte. Das neue Werk wieder einem Buchhändler anzubieten, um vielleicht erneut »eine abschlägige Antwort zu holen; denn wie sollten sie einen jungen, namenlosen und noch dazu verwegenen Schriftsteller beurteilen?«, das war ihm unangenehm. Sein Freund Merck, über die Gewinne der Verleger informiert, meinte, man solle »dieses seltsame und gewiss auffallende Werk auf eigne Kosten herausgeben, und es werde davon ein guter Vorteil zu ziehen sein; wie er denn, mit so vielen andern, öfters den Buchhändlern ihren Gewinn nachzurechnen pflegte, der bei manchen Werken freilich groß war, besonders wenn man außer Acht ließ, wie viel wieder an anderen Schriften und durch sonstige Handelsverhältnisse verloren geht. Genug, es ward ausgemacht«: Goethe kaufte das Papier, und Merck sorgte für den Druck – 500 Exemplare wurden wagemutig gedruckt. Weil Goethe die Exemplare nicht schnell genug zu verteilen vermochte, erschienen alsbald Nachdrucke von Verlegern, die die beachtliche Nachfrage befriedigten, Goethe aber keinen Kreuzer zahlten. Und da überdies die von Goethe verkauften Bücher – er setzt selbst wohl kaum einhundert Exemplare ab – so bald keine Einnahmen, ohne Bankverbindung »am allerwenigsten eine bare«, zeitigen konnten, war Goethe höchst verlegen, wie er nur das Papier bezahlen sollte. Mit seinem nächsten Werk Die Leiden des jungen Werther, dem seinerzeit einzigen großen Erfolg der als Sturm und Drang bezeichneten Genieliteratur, wandte Goethe sich dann wieder an einen Verleger, der ihm jedenfalls so viel an Honorar zahlte, dass er wieder bei Kasse war. Auch die zweite Auflage des Götz überließ Goethe gegen Honorar dem Verleger Deinet, der in Abstimmung mit Goethe im Buch vermerkte, dass man den Nachdruck »nicht weiter zu beklagen hätte, wenn derselbe mit etwas weniger Flüchtigkeit veranstaltet worden wäre.«10)
<html><aside class=„betont-ausschnitt“>Das Kopieren oder den Nachdruck konnte Goethe mit rechtlichen Mitteln nicht unterbinden. Die vertraglichen Ansprüche der beteiligten Parteien, Autor, Drucker, Papierhändler, Buchhändler und Verleger, waren selbstverständlich zu erfüllen.</aside> </html>
Aus juristischer Sicht hatte ein Autor in Deutschland auch 1770 noch kein eigenes Recht an seinem Werk. Erst im 19. Jahrhundert traten verschiedene Urhebergesetze in Kraft, zuerst in einzelnen Bundesstaaten, 1870 dann im Norddeutschen Bund im nächsten Jahr im Deutschen Reich.11) Die Autoren konnten in aller Ruhe ihr Werk drucken lassen und Rechte zum Druck an Buchhändler abtreten, ohne befürchten zu müssen, dass ein Nachdrucker ihnen zuvorkam. Das Nachdruckverbot wurde auf andere Arten der Verbreitung des Werks im gesetzlichen Sinne, etwa die Aufführung auf der Bühne oder die Sendung über Funk und als Film, erweitert. Im 20. Jahrhundert etablierten sich nach französischem Vorbild die Verwertungsgesellschaften. Heutzutage meldet der Autor sich bei der VG Wort an und erhält Ausschüttungen aus den Erlösen, die die Verwertungsgesellschaft beispielsweise von Herstellern von Kopiergeräten bezieht.
4.1.5 Persönlichkeitsrechte
Zu dem vermögensrechtlichen Schrifteigentum des badischen (1810) oder preußischen Urheberrechts (1837) traten die Persönlichkeitsrechte hinzu, namentlich
- das Recht, zu bestimmen, ob und wie das Werk zu veröffentlichen ist;
- das alleinige Recht, den Inhalt des Werkes öffentlich mitzuteilen oder zu beschreiben, solange weder das Werk noch der wesentliche Inhalt oder eine Beschreibung des Werkes mit Zustimmung des Autors veröffentlicht ist;
- das Rückrufrecht wegen gewandelter Überzeugung;
- das Recht auf Anerkennung der Urheberschaft und zur Bestimmung, ob das Werk mit einer Urheberbezeichnung zu versehen ist;
- das Recht, eine Entstellung oder eine andere Beeinträchtigung des Werkes zu verbieten, sofern diese geeignet ist, die berechtigten geistigen oder persönlichen Interessen des Autors am Werk zu gefährden.
Die Persönlichkeitsrechte sind von ihrer prinzipiellen Wirkungsweise auch Kopierverbote unter bestimmten Bedingungen und richten sich gegen Umstände, die teilweise bereits von Platon kritisiert wurden, nämlich dass Dionysios II. seine Gedanken als Schrift veröffentlicht hatte, obwohl Platon die Veröffentlichung nicht befürwortet hatte oder dass andere seine (Platons) Gedanken entstellt in die Welt hinausgeschrieben hätten. Die Anerkennung der Urheberschaft gab es ebenso bei den Griechen, indem Werke der bildenden Kunst mit Signaturen versehen wurden. Durchsetzen konnte sich das Persönlichkeitsrecht aber erst in der Zeit von der Paulskirchenversammlung bis zur Weimarer Republik. Es war eine Phase, in der die Geisteshaltung der Bildungsbürger von Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Schopenhauer, Nietzsches Übermenschen, dem Sozialdarwinismus oder der aufkommenden Psychoanalyse dominiert wurde. Wilhelm Dilthey sprach über den Zusammenhang der dichterischen Einbildungskraft mit dem Wahnsinn und zitierte zahlreiche Autoren, die etwa über die abnorme oder die »pathologische Verfassung des Genies« (Schopenhauer) schrieben.12)
In der romantischen Kunst wurde das Individuum idealistisch überhöht, mit Wagner wurde die Musik zu einem Rausch der Gefühle. Thomas Mann zeichnete in Buddenbrooks das Bild des deutschen Bürgertums in den Jahren von 1835 bis 1877, das sich in ein unsensibles, aber wirtschaftlich erfolgreiches und zupackendes Unternehmertum und die morbide Dekadenz des lebensuntüchtigen Künstlers spaltet.13) Josef Kohler suchte die Rechtfertigung für das Urheberrecht nicht mehr im römischen Recht oder in der Vernunft oder gar in volkswirtschaftlichen Vorteilen, sondern zitierte aus Mundts Vorlesungen über die Menschen- und Thierseele14): »Auf instinktive Erkenntniß gründet sich überall das Gefühl und stets ist es Aufgabe der Wissenschaft, den dunklen Naturlaut, der im Gefühl sich äußert, in die klare Sprache des Denkens zu überzuführen.«15) In einer Abkehr zur aufklärerischen Vernunft wurde der historisch ermittelte Volksgeist, das echte und unmittelbare Rechtsgefühl einer Kultur, zur natürlichen und damit legitimen Quelle des Rechts.
In England und Neuengland entstanden die bürgerlichen Rechte einschließlich des Copyrights in der Zeit der rationalen Aufklärung mit einer politisch und wirtschaftlich starken bürgerlichen Oberschicht. Das Recht hatte die Aufgabe, die Verteilung der ökonomischen Chancen zu regeln.
Wie die Handelsnation England das Copyright als Handelsgut konstruierte, so entstand die monistische Symbiose von Vermögensrecht und Persönlichkeitsrecht im deutschen Urheberrecht als Spiegelbild seiner Zeit.
Das Urheberrecht nach deutschem Verständnis ist zu unterscheiden vom geistigen Eigentum, das wiederum im Gegensatz zum Sacheigentum steht: »Das Urheberrecht gewährt dem Werkschöpfer oder seinem Rechtsnachfolger nur Ausschließlichkeitsrechte am (immateriellen) geistigen Eigentum, nicht aber ein Recht auf Eigentum oder Besitz an den einzelnen Werkstücken«, also den körperlichen Gegenständen. 16) Das Urheberrecht ist deshalb vom geistigen Eigentum zu unterscheiden, weil es – je nach Anschauung – ein Mehr oder etwas Anderes ist: Mehr, weil das Persönlichkeitsrecht hinzukommt, oder etwas Anderes, weil das Persönlichkeitsrecht dominiert.17) Das Persönlichkeitsrecht wurde zum immanenten Bestandteil des Urheberrechts. Wenn das Persönlichkeitsrecht nicht vor 1850 als gesondertes Recht erörtert wurde, muss man dies als rechtshistorische Tatsache akzeptieren. Setzt das Urheberrecht im eigentlichen Sinne beides, das Vermögens- und das Persönlichkeitsrecht voraus, kann man vor dieser Zeit nicht von einem Urheberrecht in deutschen modernen Sinne sprechen.18) Rechte gegen Plagiate, Entstellung oder das Recht auf Namensnennung können für Autoren oder Künstler auch von finanzieller Bedeutung sein, da der Wert eines Werks spätestens ab der Geniezeit vom Namen des Urhebers abhing. Aber der Marktwert eines Künstlernamens betrifft kaum die Persönlichkeit, denn dann müsste man sie in Geld aufwiegen können.
4.1.6 Honorargerüchte
In der Praxis änderte sich durch das Persönlichkeitsrecht für den Autor von 1500 wie für den von heute wenig, da der Buchdruck und -verkauf ein mühseliges Geschäft ist. Fast alle Autoren schließen deshalb Verträge mit Verlegern, die sich um den gewerblichen Teil wie Satz, Gestaltung, Druck, Werbung, Vertrieb und Buchhaltung kümmern und den Autoren das vereinbarte Honorar bezahlen oder den vereinbarten Druckkostenzuschuss kassieren. Aus rechtlicher Sicht ist heute wie im 16. Jahrhundert der Vertrag mit dem Verleger die entscheidende Grundlage für den Autor. Daraus resultiert die – allerdings zu simple – Schlussfolgerung: Wenn der Verleger mit einem Werk viel Gewinn macht, kann er dem Autor auch ein hohes Honorar bezahlen. Wird das Werk nachgedruckt, reduziert dies den Gewinn des Verlegers und damit das Honorar des Autors, der am Gewinn des Verlegers partizipiert.
Luther bekam für seine Arbeit nichts, weil er nichts verlangte, andere Autoren erhielten eine Handvoll Freiexemplare oder Naturallohn in Form von Büchern anderer Autoren
- Sigmund von Birken erzielte im Jahr 1665 Einkünfte in Höhe von 450 Gulden19) und
- Hermann Hesse zahlte 1899 einen Druckkostenzuschuss in Höhe von 175 Reichsmark, damit sein Werk in 600 Exemplaren erscheinen konnte.20)
An der rechtlichen Situation hat sich für den Autor nicht viel geändert: Er erhält wie zu Luthers Zeiten immer noch das Honorar, das er mit dem Verleger vereinbart hat, denn das entscheidende „Recht“ wurde in aller Regel auf den Verleger übertragen. Hinzu getreten sind vor allem die Einnahmen der Verwertungsgesellschaften.21)
<html><p class=„zitatbox“>Nach den Anschauungen in Deutschland des 16. Jahrhunderts war der Nachdruck ein ganz legitimes Geschäft.</p></html>
Im 15. und 16. Jahrhundert war die Vorstellung, dass ein geistiges Werk Eigentum einer Person sein könnte, nicht verbreitet.22) Nach den Anschauungen des 16. Jahrhunderts war der Nachdruck in Deutschland ein ganz legitimes Geschäft.23) Schließlich galt das Abschreiben der Handschriften in den letzten Jahrtausenden auch nicht als anstößig. Es gab in Griechenland schon seit Alexander dem Großen und in Rom gewerblichen Handschriftenhandel, in Alexandria und wohl auch Karthago bedeutende Bibliotheken, aber in wirtschaftlicher Sicht standen die Materialien und die Sklavenarbeit im Vordergrund.24) Bezahlt wurde die Ware wie bei einem Töpfer, Schuster oder Tuchhändler. Und ähnlich wurde die Sachlage auch in Deutschland eingeschätzt. Die Kosten für Material, überhaupt alle mit der Herstellung der Ware im Zusammenhang stehenden Aufwendungen und die Arbeit standen im Vordergrund; jedoch nicht die Arbeit der (oft genug seit Jahrhunderten verstorbenen) Autoren. Im 15. Jahrhundert wurden auch kaum Originalwerke lebender Autoren herausgebracht, sondern klassische Texte und Gebrauchsliteratur aufbereitet. Diese textkritischen Arbeiten der sogenannten Kastigatoren wurden entlohnt.25)
<html><figure class=„rahmen mediaright“>
</html>
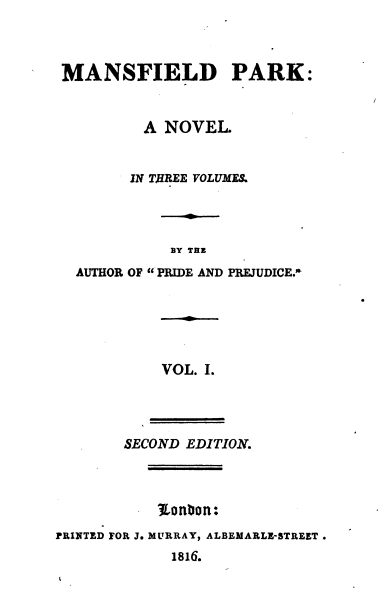 <html><figcaption class=„caption-text“>By the author of …</figcaption></figure>
</html>
<html><figcaption class=„caption-text“>By the author of …</figcaption></figure>
</html>
Die Maxime: »Ich habs umb sonst empfangen, umb sonst hab ichs gegeben und begere auch dafur nichts«, so Luther in der Einleitung seiner Bibelübersetzung, war weithin unter den Autoren gültig. Die christlichen Autoren sahen oft ihr Werk nicht als Eigenes an und sich selbst, wie in den Jahrhunderten zuvor, nicht als Subjekt der Erkenntnis, denn die Schöpfung von etwas Neuem war der göttlichen Macht vorbehalten. Bevor die Autoren ein Bewusstsein für ihre eigene Leistung entwickeln konnten, musste das im Mittelalter geprägte Bild der göttlichen Eingebung überwunden werden.26)
Anonyme Autoren
Bis weit in das 18. Jahrhundert hinein trug der in Europa am meisten gelesene belletristische Literat den Namen Anonym. Nur bekannte Autoren wie Gellert, von Kotzebue, Iffland oder Gottsched ließen ihren vollen Namen auf das Titelblatt setzen.27)
<html><figure class=„rahmen mediaright“>
</html>
 <html><figcaption class=„caption-text“>Name, Titel und Wirkungsort</figcaption></figure>
</html>
<html><figcaption class=„caption-text“>Name, Titel und Wirkungsort</figcaption></figure>
</html>
Laut den gängigen deutschen Darstellungen zum Urheberrecht soll angeblich das fehlende Urheberrecht der Grund dafür gewesen sein, dass die Autoren nicht namentlich genannt wurden. Dass Anonymität bei Sachbuchautoren oder Komponisten nicht die Regel war, wird zumeist übergangen. Gelehrte setzten aber in Deutschland schon vor dem Dreißigjährigen Krieg ihren Namen, den Wirkungsort und ihre soziale Stellung stolz auf den Titel.28) Umgekehrt war in Großbritannien die Anonymität selbst bei den bekanntesten Autoren in der Belletristik trotz geltendem Copyrights auch noch nach 1800 vollkommen üblich, als in Deutschland die namentliche Nennung des Autors längst Standard war.
Honorar keine Gegenleistung
Das Honorar der Autoren sollte keine Gegenleistung für die Schrift sein, sondern Auszeichnung durch den Gönner oder die Obrigkeit für besondere Leistungen oder Anerkennung der Kollegen. Autoren ließen sich nicht für den Text, sondern für die Textrevision und Korrekturen bezahlen; sie arbeiteten für und wohnten beim Verleger; sie bekamen Freiexemplare und andere Geschenke; sie rechneten mit Geld oder Gnadengehältern von Fürsten und anderen reichen Gönnern, denen sie das Werk widmeten. Jedoch verwahrten sie sich gegen das Ansinnen, es habe sich um schnödes, schimpfliches Honorar gehandelt.29) Dies war wohl auch durch die Auffassung der Kunden, in erster Linie Fürsten und die Kirche, bedingt, die nach anderen Prinzipien als denen der modernen Geldrechnung des Marktes, des Tausches von Leistung und Gegenleistung nach einer rationalen Analyse der Kosten und des Nutzens, entlohnten.
Die Annahme von Pohlmann30), die Autoren hätten sich »nur gegen eine Werkverwertung in bestimmter, entwürdigender Form« gewendet, nämlich die Weitergabe im Dedikationswege, um vom reichen Empfänger eine finanzielle Gegenverehrung zu erhalten, lässt sich angesichts der über Jahrhunderte gängigen Praxis kaum nachvollziehen. Bei der in Europa verbreiteten Dedikation schenkt der Autor oder Komponist ein Exemplar seines Werkes einem Gönner in Erwartung eines finanziellen Gegengeschenks, das oft als Gegenverehrung, pro honorario, gewährt wurde.
In Deutschland stand man im 16. Jahrhundert einem besonderen Autorenhonorar noch zweifelnd gegenüber. Es gab eine Berufung zum Autor, nicht jedoch den Beruf Autor. Die wenigen Autoren hatten zwangsläufig ihr Auskommen aufgrund ihrer beruflichen oder gesellschaftlichen Stellung, sei es als Geistlicher, Adliger, Wissenschaftler oder an einem Fürstenhof tätiger Autor. Bis gegen Ende des 17. Jahrhunderts konnten nur wenige Autoren nennenswerte finanzielle Vorteile aus dem Verkauf ihrer Werke ziehen.31) Das war damals aber in aller Regel nicht notwendig, denn Autoren wurden – wie heutzutage die meisten wissenschaftlichen Autoren auch – auf andere Art entlohnt. Feather32) knüpft die Entdeckung des Berufs Autor zum Gelderwerb an die Erfindung des Buchdrucks, wobei es jedoch noch zwei Jahrhunderte gedauert haben soll, bis dies erkannt wurde. Es ist merkwürdig, wenn bis in das 18. Jahrhundert hinein Generationen von Schriftstellern die Existenz des Berufs nicht erkannt haben sollen. Die Drucktechnik war nur eine von mehreren Bedingungen.
Patronage und Auftragsarbeiten
Schriftstellerpatronage war in Deutschland nie ein verbreitetes Phänomen, anders die Auftragsarbeiten: Die Maler oder Komponisten führten Auftragsarbeiten für einen Fürsten oder die Kirche aus und mussten mehr oder minder genau bestimmte Werke liefern. Autoren nahmen entsprechende Aufträge an und verfassten Texte gegen Entgelt für einen bestimmten Anlass wie eine Hochzeit, ein Jubiläum usf. Musiker waren als Hofkomponist oder Kapellmeister angestellt, Maler bezogen ein festes Gehalt von der Kurie oder von einem Gönner. Italien war in dieser Hinsicht – wie allgemein zu dieser Zeit – moderner, und manch ein berühmter Literat oder Dozent erhielt schon im 15. Jahrhundert eine Patronage, die ihn mit 500 bis 2000 Gulden im Jahr in die obere Schicht brachte. Leonardo da Vinci bezog in Mailand ein Jahresgehalt von 2000 Dukaten; in Frankreich erhielt er 35.000 Francs jährlich, ausreichend für ein fürstliches Leben.33)
Die Ansicht, bei der Ehrfurcht, welche künstlerischem und vor allem literarischen Schaffen in der Renaissance entgegengebracht wurde, hätte es der Würde des Künstlers widersprochen, eine finanzielle Entschädigung für die Verwertung der Werke entgegenzunehmen34) ist für das Mutterland der Renaissance, Italien, aber auch Spanien unzutreffend. Manche italienischen Malerfürsten der Renaissance lebten auch wie Fürsten. Cervantes starb arm, Lope de Vega oder Calderon hingegen verdienten mit ihren Schauspielen exzellent.35) Bei Erlass des französischen Urheberrechts war von den Genies die Rede, die der Unsterblichkeit im Elend entgegen gingen. Molière bekam aber in fünfzehn Jahren rund eine halbe Million Francs für seine Arbeit ausbezahlt oder Boileau hinterließ trotz seines Lebensstils eines Grandseigneurs ein Vermögen von 186.000 Francs.36)
In Deutschland war man zu dieser Zeit noch zurückhaltender. Die fromme Vorstellung eines gottgefälligen, ehrbaren Handels zum Vorteil des Ganzen erfüllte noch die Kaufleute und Industriellen des 18. Jahrhunderts. Die Bemessung der Preise im Handwerks- und Kaufmannsstand erfolgte nach dem Gebrauchswert (gerechter oder natürlicher Preis), nicht nach dem spekulativen Tauschwert, dem künstlichen Preis.37) Der gerechte Preis wurde nicht als feststehender Preis verstanden, sondern konnte aufgrund vieler Umstände variieren.
Zwar könne man den Wert der Ware theoretisch bei Berücksichtigung aller Umstände so genau bestimmen, wie das Zünglein an der Waage, lehrte der im 15. Jahrhundert einflussreiche Scholastiker Konrad Summenhart, in der Praxis sei dies aber unmöglich, so dass jeder Kaufvertrag von einer Schenkung oder einem Nachlass (die Abweichung vom Wert) begleitet sei.38) Die Abweichung des tatsächlich bezahlten Preises vom theoretisch gerechten Wert sollte aber so gering wie möglich ausfallen. Das justum pretium wurde mit der Zunahme der Arbeitsteilung und Marktwirtschaft von dem »Konkurrenzpreis als ,natürlichen` Preis« verdrängt. Als verwerflich galt ein Preis, der »nicht auf freier, d.h. durch Monopole oder andere willkürliche menschliche Eingriffe ungestörter, Marktkonkurrenz beruht.«39)
<html> <aside class=„betont-ausschnitt“>Das <em>justum pretium</em> wurde mit der Zunahme der Arbeitsteilung und Marktwirtschaft von dem Konkurrenzpreis als natürlicher Preis verdrängt.</aside> </html>
Unlauterer Wettbewerb, Habsucht und Gier, das individuelle Streben nach Reichtum ohne weiteren Zweck war nicht gottgefällig und bedeutete eine Gefahr für die Stabilität des ständischen Systems. Wenn die Autoren kein außergewöhnliches Honorar forderten, nahmen sie keine Sonderrolle ein, auch wenn vereinzelt höhere Zahlungen erfolgten. So verkaufte Thomas Murner 1514 an den Buchhändler Matthias Hupfuff in Straßburg seine Geuchmatt für vier Gulden. Der berühmte Humanist und Jurist Ulrich Zasius (1461–1535) verlangte für seine 1526 erschienenen Intellectus juris singulares von seinem Verleger in Basel fünfzig Gulden Honorar und erhielt diese auch. Dies waren – wie Kapp.40) anmerkt – durchaus bedeutende Beträge, da »1526 Pellican, allerdings ein anspruchsloser Mann, mit 16 Gulden per Jahr leben konnte und […] Scheurl um 1506 den jährlichen Unterhalt eines wittenberger Studenten auf 8 Gulden schätzte.«41)
Der Dreißigjährige Krieg hinterließ selbstverständlich im Buchhandel deutliche Spuren und reduzierte die Möglichkeiten, Honorar in Geld zu bezahlen, auf ein Minimum. Auch in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts dauerte die Misere an. Freie Schriftsteller gab es in Deutschland noch nicht.42) Das durchschnittliche Bogenhonorar betrug 12 bis 16 Groschen (gr.), gut verkäufliche Autoren erhielten einen bis drei Taler für den Bogen. Oft wurden auch 100 Exemplare, was regelmäßig einem Zehntel der Gesamtauflage entsprach, an Stelle baren Geldes bezahlt.
Bücherhonorar
Daneben gab es das Bücherhonorar, also Bücher aus dem Sortiment des Verlegers.43) Das Bücherhonorar waren keine Freiexemplare der eigenen Werke, sondern eine Auswahl unterschiedlicher Titel anderer Autoren, die der Verleger entweder aus dem eigenen oder auch einem fremden Verlag dem Urheber als Gegenleistung für das Werk überließ. Goldfriedrich44) sagt, dass das Bücherhonorar bis 1740 die Regel war und vereinzelt bis in das 19. Jahrhundert anzutreffen sei. Bücher wurden teilweise als Honorar vereinbart, andererseits auch als stillschweigende Vorschüsse oder Abschlagszahlungen auf das ihnen zustehende Honorar einer noch ausstehenden Veröffentlichung verstanden.45) So haben die Autoren trotz Anspruch auf Zahlung in bar Bücher genommen (teilweise wurde ihnen der damals übliche Buchhändlerrabatt in Höhe eines Drittels weitergegeben), da es für beide Seiten von Vorteil war.46)
Selbst nach 1800 kauften die Autoren ihre Bücher noch bei ihrem Verleger, die – wie in den Jahrhunderten zuvor – oft Sortimentsbuchhandel betrieben. Da die Autoren selbstverständlich auch Leser waren, hätten sie einen Teil der Bücher wohl sowieso erworben, andere Exemplare des Naturalienhonorars konnten sie unter Umständen bei ihrem Buchhändler oder Kollegen eintauschen und eigene Werke Gönnern widmen (Dedikation).47) Es wurde von den Autoren also nicht zwingend als minderwertiger Ersatz an Stelle eines Honorars in klingender Münze angesehen.48)
<html> <p class=„zitatbox“>Die Gelehrten sind Kunden des Buchhändlers und die Buchhändler Kunden der Gelehrten.</p> </html>
Bis zum Siebenjährigen Krieg bestand die Mehrheit der Kunden des Buchhändlers aus einer kleineren Anzahl von Gelehrten.49) Die Autoren und die Leser der Bücher kannten sich, waren oft beides zugleich. Beier stellte 1690 fest, dass die Gelehrten Kunden der Buchhändler sind und die Buchhändler Kunden der Gelehrten.50) Beispielsweise vermerkt Konrad Pellican 1535, dass er von seinem Verleger Froschauer für seine Arbeit noch 186 Gulden bekäme, er umgekehrt seinem Verleger aber 44 Gulden für Bücher schulde.51)
1675 schrieb Ahasver Fritsch, dass die Buchführer den Verfassern billigerweise eine Belohnung oder Verehrung geben mögen. Die Bücher würden von den Buchdruckern und Buchführern für ein bestimmtes Entgelt verkauft, wobei die Kaufleute den Profit, die Autoren aber die Ehre hätten. Aus dem Bücherschreiben solle kein Handwerk gemacht werden; es sei eine vortreffliche Sache, die nicht nach Geld zu schätzen, noch durch Geld zu verunehren sei. Es sei gerechtfertigt, wenn den Autoren für ihre Arbeit und ihren Schweiß eine Verehrung erbracht werde. Jedoch seien die Preise einzuschränken, so dass weder der Bücherschreiber noch der Buchführer als gewinnsüchtig und geldgierig angesehen werden könnten.52)
Bei Fritsch vermengten sich mehrere Vorstellungen über das Honorar, die sich grob wie folgt unterscheiden lassen:53)
- Die am Beispiel Roms gezeigte Haltung, dass Autoren nicht wegen des Geldes, sondern um der Ehre halber schreiben. Diese war in Rom mit dem sozialen Gefüge verbunden, in der Arbeit als erniedrigend und eines freien Mannes unwürdig angesehen wurde.Dieses Haltung findet sich schon bei Aristoteles. Beutezüge, Plünderungen oder Sklavenhaltung in der Landwirtschaft waren einem Herrn angemessene Erwerbsmethoden. Erst nach der Barockzeit und damit später als Fritschs Schrift – mit dem Auftreten der nahezu religiösen Verehrung für manche Künstler – entwickelte sich der Gedanke, dass die Künstler für das Wahre und Schöne, nicht für schnödes Geld schreiben (müssten).
- Die in der Scholastik aber auch von Luther vertretene Lehre vom gerechten Preis, der sich nach dem Wert der verwendeten Materialien und dem Arbeitsaufwand richtet: »Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen«, lautete die Maxime, die arbeitsfreies Einkommen, Renten oder Spekulationsgeschäfte als unchristliche ablehnte54) Auch in den Entscheidungen zu den Ausschließlichkeitsrechten der englischen Krone 1601 und 1602 wurde mit der Ablehnung eines leistungsfreien Einkommens, das die Monopole verschaffen könnten, argumentiert.55)
- Hinzu kam die moraltheologische, naturrechtlich begründete Anschauung vom standesgemäßen Unterhalt, wonach der ungelernten Arbeitskraft als Entlohnung das Existenzminimum, der gelernten ein höheres Entgelt gebührt (während die privilegierten Stände Adel und Kirche den Rest unter sich aufteilen).
- Die mit der Neuzeit auftretende Auffassung, dass das Gewinnstreben nicht unchristlich sei, sondern im Einklang mit der christlichen Arbeitsethik stehen konnte und der Klugheit entsprach, die ergänzt wurde durch die Anschauung,Wirtschaftsethik!calvinistisch dass der im Konkurrenzkampf ermittelte Marktpreis der angemessene Preis sei.
Geldzahlungen
Zu Beginn des 18. Jahrhunderts erhielten die Autoren, wenn überhaupt, eine als Vorschuss bezeichnete Einmalzahlung für das abgelieferte Werk, die entweder pauschal im Voraus festgelegt wurde oder nach der Anzahl der Druckbogen bemessen, selten aber vom Erfolg des Werkes (weiteren Auflagen) abhängig war. Das durchschnittliche Honorar für einen Bogen belief sich in etwa auf einen bis zwei Reichstaler und wurde oft als Bücherhonorar ausgezahlt, wobei die Verleger einen Teil des Buchhändlerrabatts an die Autoren weitergaben.56) Bis in die Aufklärung hinein stand die Schwierigkeit, überhaupt einen Verleger für ein wirtschaftlich riskantes Werk zu finden, im Vordergrund. Dies betraf vor allem die wenigen in deutscher Sprache schreibenden Autoren belletristischer Werke, die in der Öffentlichkeit kein hohes Ansehen genossen.Daraus resultierten billige Bücher, geringes Selbstbewusstsein und geringes Honorar.57)
Autorenehre und Honorar
Die Meinung aber, dass von 1500 bis ungefähr 1770 die Autoren ausschließlich für die Ehre schrieben, beruht auf einigen Äußerungen, etwa dass Autoren wie Erasmus und Luther Honorar als schimpflich ansahen und dass ab 1770 Autoren wie beispielsweise Herder das Schreiben um des Geldes Willen verurteilten. In den rund 250 Jahren dazwischen, so die Schlussfolgerung, muss für alle das Gleiche gegolten haben. Bereits der Begriff der Ehre, der ja eine Anerkennung beim Publikum impliziert, steht in Widerspruch zur anonymen Veröffentlichung.58) Man sollte dann eher von Selbstlosigkeit, Bescheidenheit oder Demut, nicht von Ehre, sprechen.
Zudem war die Zahlung in Büchern auch ein „Honorar“. Man muss sich die insgesamt erbärmlichen Zustände nicht nur des Buchhandels, sondern des gesamten Reichs während und nach dem Dreißigjährigen Krieg vor Augen halten. Wenn dem Autor Freiexemplare gegeben wurden, oft nicht wenige, so wurde der Autor in das Vertriebssystem des Verlegers eingebunden, denn der Autor verkaufte, tauschte oder widmete die Exemplare anderen, die aber dann beim Verleger kein zweites Exemplar kauften. Zugleich haben Freiexemplare auch den Charakter einer Risikoteilung. Im Ergebnis war die Überlassung von Büchern – angesichts der damaligen Schwierigkeiten des Handels – oft nicht schlechter als ein modernes Absatzhonorar, oft wohl sogar besser. Und wenn die gezahlten Beträge, etwa zwanzig Gulden, oft gering erscheinen, muss man berücksichtigen, dass dies das Fünffache des Jahreslohns eines Schulmeisters war.59)
<html> <p class=„zitatbox“>Es ist gerechtfertigt, wenn den Autoren für ihre Arbeit und ihren Schweiß eine Verehrung erbracht wird. Jedoch sind die Preise einzuschränken, so dass weder der Bücherschreiber noch der Buchhändler als gewinnsüchtig und geldgierig angesehen werden können.</p> </html>
Auch in anderen Bereichen spielten die Regeln des heutigen Markts einer untergeordnete Rolle, da in der Landwirtschaft noch das feudale Lehnsprinzip galt und die Handwerker mit den Zünften ein eigenes System schufen. Kaum zeigten sich eine Besserung und die Möglichkeit, höheres Honorar zu fordern, geschah dies offenbar. So stellt Goldfriedrich Klagen über die hohen Honorarforderungen um die Wende zum 17. Jahrhundert (vor dem Dreißigjährigen Krieg), in den letzten Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts und noch stärker den ersten des 18. Jahrhunderts fest.60) Auch wenn das Klagen über die hohen Kosten zum guten Ton eines jeden Kaufmanns gehört, die Honorarforderungen und -zahlungen waren nicht die große Ausnahme. Die oft gewährten fünfzig oder einhundert Freiexemplare auf gutem Papier entsprachen gerne einem Zehntel der gesamten Auflage und waren bei den damaligen engen Verbindungen zwischen den Gelehrten und Buchhändlern – Goldfriedrich 61) spricht von einem Kommissionsverhältnis zwischen Schriftsteller und Buchhändler, eine häufig anzutreffende Erscheinung – durchaus eine wertvolle Entlohnung. Koppitz bezeichnet die Ansicht, die Autoren des 16. Jahrhunderts und späterer Jahrhunderte hätten fast durchweg nichts an ihren Büchern verdienen wollen, als »Mär«.62) Die Autoren achteten aber darauf, dass ihr Auftreten in der Öffentlichkeit keinen habgierigen Eindruck erweckt, denn höher im Ansehen steigt der Autor, der ausschließlich der guten Texte wegen schreibt und das schnöde Geld verachtet.
Es ist zunächst eine einfache Fragestellung: Zieht ein Autor eine Gestaltung mit höherem Honorar einer mit niedrigerem vor, was kann einen Autor davon abhalten, diejenige mit dem höheren Honorar zu wählen und hatte er überhaupt eine Wahl? Das verbreitete Dedikationswesen, die Vielzahl an Freiexemplaren oder das Bücherhonorar zeigen, dass die Autoren durchaus ein materielles Interesse hatten. Man muss wohl genauer unterscheiden zwischen
- dem »Dedikationsunfug«, der zum Ende des 18. Jahrhunderts »zum offenen Bettel ausartete«, wie Kapp es beschreibt;63)
- einem als angemessen und gerecht erachteten Honorar;
- einem gierigen, dem gemeinen Wesen schädlichen Begehren.
Vermutlich muss man auch nach dem Gegenstand der Bücher unterscheiden. So wurden theologische Streitschriften wohl anders behandelt als derbe Volksliteratur oder wissenschaftliche Arbeiten.
Verleger
Die Verleger folgten nicht alle dem genügsamen Vorbild der christlichen Wirtschaftsethik, sondern oft genug der unbilligen Gewinnsucht. 1675 ist die Klage zu hören, die Verleger ließen die falschen Bücher drucken und verkaufen; das sind die Bücher, die sich gut verkaufen, namentlich »Schelmereyen von Buhlen-Liedern, untüchtige Historien, Famos-Libellen, Schand-Gemählde und Gedichte«, »liederliche, muthwillige und unnütze, auch vielmahl aufgewärmtes Gezeug«, an Stelle der edlen und sinnreichen Werke der Gelehrten. Daneben wurde der Geiz und die Unbilligkeit beklagt:64) Ein ähnliches Lamento findet man bei Diderot:65) Er kenne zahlreiche gute Autoren, die keinen Sou in der Tasche hätten, deren Problem aber nicht wäre, Leser für ihr Buch, sondern einen zahlenden Verleger zu finden.
- Die Verleger setzen einen anderen Namen an die Stelle des richtigen Autors. Warum wird der Name des Autors unterdrückt? Mit dem bekannten Namen lassen sich die Exemplare nicht mehr absetzen.
- Eine alte Ausgabe wird um einige Seiten erweitert und als vermehrt verkauft.
- Zwei ungangbare Werke werden zusammengebunden und als ein neues angeboten. Alte Ladenhüter werden mit einem neuen, stattlichen Titel versehen; zurückgenommen werden die Bücher nicht, wenn der Kunde merkt, dass er nicht das, was der Titel versprochen, sondern Makulatur gekauft hat.66)
- Sie nehmen das schlechteste und billigste Papier.67) Haben sie ein gutes Buch, verkaufen sie es um den doppelten Preis und liefern es von so weit an, dass der Transport mehr kostet, als das Buch.
- Wenn ein Autor ein Buch im Eigenverlag herausbringt, dann seien sich alle Händler einig: Sie bieten ihm für das Werk z. B. sechs Groschen, das sie hernach für achtzehn verkaufen. Wenn es dann an das Bezahlen der Exemplare des Selbstverlegers geht, leisteten sie nur – Papier um Papier – mit alten Ladenhütern. So sei es für einen Autor unmöglich, auch nur seine Unkosten im Selbstverlag zu erzielen.
Diese Geschäftspraktiken betrafen das Verhältnis zu den Außenstehenden, den Kunden oder dem Selbstverlag. Auch untereinander gab es Unregelmäßigkeiten. So wurden in den Büchern Privilegien abgedruckt, die tatsächlich nicht erteilt waren. Trotz Privilegien wurden die Bücher nachgedruckt. Die Drucker druckten mehr Bücher, als mit dem Verleger vereinbart, und verkauften die Mehrdrucke unter der Hand oder öffentlich auf eigene Rechnung.68)
— Eckhard Höffner 2017/10/18 20:36